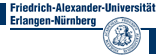
Archiv Pressemeldungen
| |
| |
| |
| 175 jahre frauenklinik in erlangen |
|
Ausstellung und Festakt zur Geschichte der Klinik Am
30. März 1828 wurde das erste Gebärhaus Erlangens feierlich
eröffnet. Vorausgegangen waren jahrelange Bemühungen des
Arztes Anton Bayer um eine geburtshilfliche Klinik für die
Universität. Aus dem Gebärhaus mit nie mehr als 100 Geburten
pro Jahr wurde eine moderne Frauenklinik mit jährlich rund
1600 Entbindungen und 3400 Operationen. Alle drei "Säulen"
des Fachgebietes sind nicht nur klinisch, sondern auch in Forschung
und Lehre vertreten: Tumorbehandlung (gynäkologische Onkologie)
und operative Gynäkologie, vorgeburtliche und Geburtsmedizin
(Pränatal- und Perinatalmedizin) sowie Hormonstörungen
(Endokrinologie) und Fortpflanzungsmedizin (Reproduktionsmedizin). Die Entwicklung des Gebärhauses zur Frauenklinik ist mit den Namen herausragender Mediziner verbunden. So verdankte die Frauenheilkunde dem ehemaligen Klinikdirektor Richard Frommel einen entscheidenden Impuls zum Umdenken bei der Therapie der lebensgefährlichen Eileiterschwangerschaft. Im Gegensatz zur damals geltenden Lehrmeinung, die abwartendes Verhalten empfahl, setzte sich Frommel für die sofortige operative Behandlung ein. Im 1. Weltkrieg und im Jahrzehnt danach entwickelte sich die Frauenklinik unter der Leitung von Ludwig Seitz und Hermann Wintz zu einem international renommierten Zentrum für die Strahlentherapie. Damals hofften viele Ärzte, Krebs alleine durch eine Strahlentherapie bekämpfen zu können. Wintz gelang ein ungewöhnlich erfolgreiches Joint-venture mit der Erlanger Firma "Reiniger, Gebbert & Schall" (RGS), die damals zu den weltweit führenden Herstellern von Röntgenapparaten zählte. Zusammen mit RGS - die später in der Siemens AG aufging - erarbeitete Wintz zahlreiche Verbesserungen für die damals üblichen Röntgen-Bestrahlungseinrichtungen. Gleichzeitig entwickelte er eine von Experten als revolutionär empfundene Methode der Röntgentherapie für gynäkologische Krebserkrankungen. Im "Dritten Reich" ließ sich Wintz allerdings für die rassenpolitischen Zwecke der Nationalsozialisten instrumentalisieren: In der Erlanger Frauenklinik wurden Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen bei Ostarbeiterinnen durchgeführt. Für einige der Frauen endete dies tödlich. Eine grundlegende
Neuorientierung erfuhr die Erlanger Frauenklinik, als Karl Günther
Ober 1962 die Leitung übernahm. Nun wurden bösartige Erkrankungen
in erster Linie wieder operativ behandelt. Obers Ziel war eine möglichst
schonende Therapie: So sollten Überbehandlungen mit ihren negativen
Folgen für die Lebensqualität der Patientinnen vermieden
werden. Im Rückblick erscheinen dabei vor allem die Untersuchungen
zum Gebärmutterhalskrebs richtungweisend. Ebenfalls trug Lang der rasanten Entwicklung Rechnung, die das Fachgebiet besonders im Bereich der Geburtshilfe und Pränataldiagnostik sowie der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin erlebte. Hier wurden große Arbeitsgruppen etabliert, die ihre Spezialgebiete in Forschung und Klinik erfolgreich vertreten konnten. Dabei kam auch der immer engeren Zusammenarbeit mit benachbarten Fachgebieten wachsende Bedeutung zu. Mit dem Wechsel in das neue Jahrtausend stellt sich die Klinik unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias W. Beckmann neben fachlichen Herausforderungen den grundlegenden Reformen im Gesundheitswesen. Als neuer Forschungsschwerpunkt wurde die molekulare Medizin in der Frauenheilkunde aufgenommen. Jährlich
werden rund 31.000 Patientinnen versorgt Weitere Informationen Mediendienst FAU-Aktuell Nr. 3110 vom 24.03.2003 |